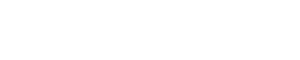Der Dokumentarfilm «Réveil sur Mars» zeigt das Leben einer Familie aus dem Kosovo, deren Töchter unter dem Resignationssyndrom leiden. Wir haben uns mit der Regisseurin Dea Gjinovci über ihre Motivation und künstlerischen Entscheidungen unterhalten.
Dea, wie bist du auf genau diese Familie gestossen?
Das erste Mal stiess ich auf diese Familie, als ich in der New York Times einen Artikel über verschiedene Kinder mit Resignationssyndrom las. Ich erfuhr, dass es sich bei der einen Familie um Roma aus dem Kosovo handelte, weshalb sie mich von den verschiedenen Betroffenen am meisten interessierte. Also wandte ich mich an die Ärztin, die sich um diese Familien kümmerte. Sie stellte mir mehrere Familien vor, bevor sie mich mit den Demiris bekannt machte. Ich glaube, sie wollte, dass ich das Ausmass des Resignationssyndroms begreife und wie viele Kinder davon betroffen sind.
Wie hat die Familie reagiert, als du den Vorschlag machtest, einen Film über sie zu drehen?
Ich habe ihnen gesagt, dass ich gern ihr tägliches Leben filmen würde, aber dass sie ihr Verhalten deshalb nicht ändern müssten. Ich glaube, sie schätzten es, dass ich mich dabei auf die Geschwister Furkan und Resul konzentrieren wollte. Ich wollte etwas ausserhalb des täglichen Lebens der Jungs kreieren, wie beispielsweise das Bauen des Raumschiffs. Die Eltern sahen, dass es für Furkan und sein Selbstvertrauen förderlich war, an einem kreativen Projekt wie diesem teilzunehmen.
«Jedes Mal, wenn wir nach Schweden zurückkehrten, hatten wir die Hoffnung, dass die Mädchen aufwachen würden.»
Der Film handelt von einer Roma-Familie in Schweden, deren zwei Töchter jahrelang in Apathie fallen. Wie war es für dich, das mitzuerleben?
Am Anfang, als ich die Mädchen kennenlernte, war es ziemlich seltsam, weil man zuerst denkt, dass sie nur schlafen. Also betritt man das Zimmer und flüstert, weil man sie nicht wecken will. Ich habe dann das Verhalten der Eltern beobachtet. Sie teilten ihnen zum Beispiel immer mit, wenn sie das Zimmer betraten, warum sie es taten, was sie im Zimmer machten, und sprachen einfach ununterbrochen mit ihnen, als ob sie wach wären. Das habe ich dann auch so gemacht. Als wir mit den Dreharbeiten begannen, stellte ich mich ihnen vor und erklärte, dass wir sie filmen würden. Es ging immer darum, sie wissen zu lassen, dass man sich ihnen zuwandte.

Dea Gjinovci wurde in Genf geboren und ist schweizerisch-albanische Drehbuchautorin und Regisseurin. Ihr Film «Sans le Kosovo» gewann mehrere Auszeichnungen. Nun erscheint ihr Dokumentarfilm «Réveil sur Mars» in den Schweizer Kinos.
Während des ganzen Drehprozesses übernimmst du ganz unwillkürlich die Erwartungen der Eltern. Denn jedes Mal, wenn wir nach Schweden zurückkehrten, hatten wir die Hoffnung, dass die Mädchen aufwachen würden. Wir befanden uns immer in diesem Zwischenstadium, in welchem wir entweder sehr hoffnungsvoll waren, weil vielleicht eines der Mädchen etwas stärker blinzelte oder sich etwas bewegte, und dann gab es andere fürchterliche Momente, in denen wir dachten, dass die Mädchen bei einer Absage der Aufenthaltsbewilligung niemals aufwachen würden.
Wenn die Demiris während des Films einen negativen Asylentscheid erhalten hätten oder zum Beispiel Furkan oder den Mädchen etwas passiert wäre, dann weiss ich nicht, wie ich hätte weitermachen können. Man wird so stark in ihr Leben hineingezogen, dass man die gleichen Hoffnungen teilt. Diese Situation war äusserst schwierig für mich, aber es war der einzige Weg, um diesen Film zu realisieren. Erst jetzt, nachdem ich den Film fertiggestellt habe, komme ich aus dieser emotionalen Verfassung heraus. Da ich heute weiss, dass sich die Demiris viel besser eingelebt haben und dass die Dinge für sie in Schweden positiver verlaufen werden, habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie loslassen kann. Aber es hat lange gedauert. Die Situation ist so unmenschlich und aussergewöhnlich, dass man sich nicht einfach abwenden kann.
«Ich wollte sicherstellen, dass sich die Familie mit uns wohlfühlt und uns vertraut.»
Der Film wird aus der Sicht des 11-jährigen Bruders Furkan erzählt, welcher die ganze Tragik mitbekommt und eine Rakete bauen will, um dem Ganzen zu entfliehen. Du begleitest ihn dabei. Wie hast du es geschafft, sein Vertrauen zu gewinnen?
Es geht darum, die persönlichen Grenzen zu respektieren. Das heisst, dass man nicht die ganze Zeit filmen muss. Manchmal ist es einfach besser anwesend zu sein und zu beobachten. Wir haben uns mit Furkan wirklich angefreundet. Er hat mir sehr vertraut. Wir haben uns mit ihm und seinem Bruder getroffen, haben Spiele gespielt und sind ins Kino gegangen. Ich wollte mich mit ihm ohne Kamera unterhalten und eine Beziehung zu ihm aufbauen. Es ging nicht nur um die Tatsache, dass wir einen Film drehen wollten. Es ging darum, zu verstehen, wie er sich im Hinblick auf die Situation seiner Familie fühlte. Um dir diese Dinge zu erzählen, muss sich ein Kind bei dir aufgehoben fühlen. Was im Film zu sehen ist, sollte repräsentativ sein dafür, worüber wir gesprochen haben. Man soll verstehen, woher seine Schuldgefühle kommen, warum er sich auf diese bestimmte Art und Weise verhält und wovon er träumt.
«Réveil sur Mars» ist ein Dokumentarfilm, und doch macht es den Anschein, als würde er zu einem Spielfilm verschwimmen. Dich und die Crew nimmt man überhaupt nicht wahr und hat das Gefühl, die Familienmitglieder seien unter sich. Wie habt ihr das geschafft?
Das hat verschiedene Gründe. Erstens war es stets dieselbe Crew, die gedreht hat. Ich wollte keine neuen Leute am Set haben. Es war mir ein grosses Anliegen, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Ich wollte sicherstellen, dass sie sich mit uns wohlfühlt und uns vertraut. Zweitens haben wir auch ausserhalb der Dreharbeiten viel Zeit mit der Familie verbracht. Ich beobachtete sie, führte Gespräche, verbrachte den ganzen Tag mit der Familie und der Crew. So lernten wir uns wirklich kennen. Als ich dann zum Drehen kam, fühlte es sich ziemlich natürlich an, und gleichzeitig wusste ich durch die Besuche, was ich auf die Leinwand bringen wollte. Ich hatte schon oft gesehen, wie Dinge getan wurden und welche Routinen zum Alltag gehörten. Ich habe also versucht, nicht zu viel zu filmen, und wenn ich etwas filmte, wusste ich, worauf ich mich konzentrieren wollte. Es ging darum, die Zeit der Familie zu respektieren und zu wissen, wann man sie für ein paar Tage in Ruhe lassen musste. Natürlich war es ein Prozess, bis sich die Familie vor der Kamera wohlfühlte. Ich habe aber nie versucht sie zu filmen, wenn es etwas gab, das sie nicht preisgeben wollten.
Wo sind die Grenzen zwischen Dokumentation und Fiktion? Wie viel ist Doku und wie viel wurde nach Drehbuch gedreht?
Die ganzen Szenen, die im Haus und mit den Jungs gedreht wurden, sind grösstenteils dokumentarisch. Es gibt einige Szenen, die mehr inszeniert wurden, weil sie Teil der imaginären Erzählung sind, wie beispielsweise der Bau des Raumschiffs. Für dessen Bau hatten wir Hilfe von Künstler*innen und Konstrukteur*innen. Ich wollte, dass die Leute verstehen, dass es sich am Ende eher um eine Fiktion handelt. Der 11-jährige Furkan wünscht sich, er könnte mit dem Raumschiff zum Mars fliegen. Am Ende tauchen wir also in Furkans Traumwelt ein und verweilen in dieser metaphorischen Ebene.
Hast du das Gefühl, dass du als Albanerin einen Zugang zu der Familie hattest, den andere nicht gehabt hätten?
Auf jeden Fall! Ich hätte den Film nicht gemacht, wenn ich nicht aus dem Kosovo käme oder kein Albanisch sprechen würde. Der Grad an Intimität, den man in dem Film sieht, beruht auf der Tatsache, dass eine Beziehung zu der Familie aufgebaut wurde, die über den Dokumentarfilm hinausgeht. Das Verständnis für den kulturellen und sozialen Kontext, aus dem die Familie kommt, ist äusserst wichtig. Bei Dokumentarfilmen muss man sich meiner Meinung nach generell fragen, ob man wirklich die geeignete Person ist, um eine Geschichte zu erzählen. Ich denke, dass ich bei dieser Familie die Eigenschaften mitbrachte, die mich zur richtigen Person machten.
«Die Hoffnung treibt uns an, und wenn man uns die Hoffnung nimmt, nimmt man uns den Antrieb zu leben.»
Im Film kommen verschiedene Themen zur Sprache: Es geht um die Flüchtlingsthematik, Diskriminierungen gegenüber über Roma, Ängste und Traumata, es geht um das Thema Behinderung und wie man damit umgeht. Was wolltest du mit diesem Film aufzeigen? Was ist deine Botschaft?
Ich wollte keinen politischen Film über die Flüchtlingskrise oder über Migration machen. Ich wollte mich von der Politik lösen und stattdessen auf den Kern und die Werte unserer Gesellschaft zurückkommen. Das Resignationssyndrom wird im Grunde durch Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit verursacht. Und wenn man überhaupt keine Hoffnung mehr hat, zerfällt man. Man wünscht sich, dass es einen nicht gibt. Keine Hoffnung zu haben heisst, dass man keine Zukunft hat. Die Tatsache, dass diese Kinder im Koma liegen, bedeutet, dass sie wirklich jede Art von Hoffnung verloren haben. Ähnliche Syndrome, die Menschen widerfahren sind, gab es auch in den deutschen Konzentrationslagern.
Ich wollte, dass die Leute verstehen, wie gewalttätig und brutal Migrationspolitik und ihre Behörden sein können, ohne dass sie gewalttätig und brutal erscheinen. Die psychologischen Auswirkungen sind enorm. Die wichtigste Frage für mich ist: Was für eine Gesellschaft wollen wir sein und wie können wir allen, die in unserer Gesellschaft leben, ein Gefühl der Würde vermitteln? Es geht bei dieser Frage darum, wie wir Menschen im Allgemeinen behandeln wollen. Man kann Asylsuchenden ihre Menschlichkeit nicht nehmen. Diese Botschaft war mir für den Film wichtig. Die Hoffnung treibt uns an, doch wenn man uns die Hoffnung nimmt, nimmt man uns den Antrieb zu leben.
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Von Merita Shabani (Interview und Übersetzung)