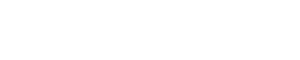Erwartungen von den Eltern, Erwartungen von der Schweizer Gesellschaft – aber was wollen eigentlich wir selbst? Diese Frage stellt sich unsere Kolumnistin Arzije.
Letzten Sommer habe ich mich für einen Masterstudiengang beworben, wurde angenommen und habe mich dann schweren Herzens wieder abgemeldet. Zum Teil aus gesundheitlichen Gründen, aber auch weil ich mir nicht sicher war, ob es wirklich das war, was ich machen wollte, oder ob ich immer noch die Erwartungen meiner Eltern und der Gesellschaft im Hinterkopf hatte.
Wie weiss man, wer man wirklich ist? Und ob es wirklich das ist, was man will, oder ob man sich durch den Leistungsdruck in die Irre führen lässt? Vor allem, wenn man mit dem Druck aufgewachsen ist, zeigen zu müssen, dass man fähig ist? Dass man es auch schaffen kann?
Wir meinten, wir seien alle von der gleichen Startlinie gestartet.
In meiner Kindheit und Jugend gab es diese Wokeness bezüglich Privilegien nicht. Wir meinten, wir seien alle von der gleichen Startlinie gestartet und dementsprechend drückte ich auch stärker aufs Gas, um mithalten zu können. «Ihr seid in der Schweiz aufgewachsen. Ihr habt alle Möglichkeiten, die wir nie hatten», hiess es stets zuhause. Wir haben es in der Tat viel leichter, als meine Eltern es in ihrem Leben jemals hatten. Aber wir haben es nie so leicht wie Personen aus einem wohlhabenden und in der Schweiz gebildeten Umfeld.
Ich wuchs mit der Vorstellung meiner Eltern auf: Studieren, einen gebildeten Albaner heiraten, eine Familie gründen, aber auch Karriere machen — immense Erwartungen.
Gegen das Heiraten und Kinderkriegen habe ich mich, seit ich 16 Jahre alt bin, stark gesträubt. Vielleicht weil ich gegen meine Eltern rebellieren wollte, vielleicht aber auch weil ich nicht wollte, dass mich die hippen alternativen Mitschüler*innen als konservative Albanerin sahen. Ein ewiges Ping-Pong zwischen mir, meinen Eltern und der schweizerischen Gesellschaft.
«Ihr habt alle Möglichkeiten, die wir nie hatten.»
Nachdem mich dann mein Freund letzten Frühling gefragt hatte, war ich selbst erstaunt darüber, wie aufgeregt und glücklich ich war, dass er sein Leben mit mir verbringen wollte. «Du bist den ganzen Abend mit einem geraden Rücken umher stolziert», neckte er mich am nächsten Tag.
Dennoch brauchte ich einige Monate für mich, bis ich es öffentlich nach aussen trug. Wie sollte ich das nun anderen erzählen, ohne dass sie mich wieder in Schubladen steckten? Dabei haben sich eigentlich fast alle einfach nur gefreut. Ich hatte die Vorurteile, die ich in meiner Kindheit so oft gehört hatte, verinnerlicht und auf mich selbst projiziert.
Der Traum war nicht meiner. Es war der meines Vaters.
Doch dass ich meinen Master noch vor Studienbeginn gecancelt habe, hat meinen Vater dennoch zutiefst enttäuscht. Ich fühlte mich in meine Kindheit zurückversetzt, als ich eine Fünf schrieb und er mich fragte, warum ich keine Sechs geschafft hatte. Dann verstand ich, dass es eigentlich nichts mit mir zu tun hatte. Der Traum war nicht meiner. Er war der meines Vaters.
Dadurch, dass meine Eltern ihr Leben in ihrer Heimat aufgegeben haben, und damit ihre Träume, habe ich mein ganzes Leben eine Schuld verspürt, ihre Opfer wettzumachen. Auch wenn ich heute denke, dass man den Eltern nichts schulden sollte, haben sich diese Schuldgefühle tief in mein Innerstes eingenistet und dagegen kommt der Kopf nicht so leicht an. Doch machte es denn wirklich Sinn, ihren Wünschen zu folgen, nur damit ich dann auch – wie sie – ein fremdbestimmtes Leben führte?
Ich habe mein ganzes Leben eine Schuld verspürt, ihre Opfer wettzumachen.
Und dasselbe mit der Schweizer Gesellschaft. Sobald ich meine Herkunft preisgab, musste ich Stellung nehmen. Nicht nur zu mir als Person sondern zu einem ganzen Volk. Eine ständige Bewertung, die einem das Gefühl gibt, nicht sich selbst und nicht genug sein zu dürfen. Konnte ich nicht einfach für mich selbst genug sein, und endlich beginnen, mein Leben nach meinen Regeln zu leben? Denn wenn ich es jetzt nicht tat, wann dann?
Um all diese Gedanken zu verinnerlichen, und mir selbst endlich Luft zum atmen zu lassen, musste ich erst ein paar Male auf dem Boden landen. Genug Male um zu verstehen und endlich zu versuchen, nach meinen Wünschen zu leben.
Ich weiss nicht, ob ich den Teufelskreis durchbrochen habe, indem ich mich vom Master abgemeldet habe. Seither fühle ich mich aber frei und versuche heute die Opfer meiner Eltern zu ehren, indem ich mein Leben so lebe, wie ich das möchte. Ein Leben frei von anderen Erwartungen, schädlichen Traditionen und Vorurteilen.