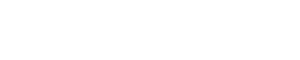Farah Rumy sitzt seit über einem Jahr für die SP im Nationalrat. Letzte Woche brach sie ein Interview mit einem Journalisten ab. Denn beim Gespräch standen nicht ihre politischen Inhalte im Fokus, sondern ihre Herkunft. Wir brauchen mehr Reaktionen wie ihre!
Obwohl Farah Rumy erst seit 2023 Nationalrätin ist, hat sie bereits eine ganze Reihe von Geschäften im Parlament eingereicht. Die meisten betreffen das Gesundheitswesen, was ganz im Sinne des Milizparlaments ihrer Ausbildung als diplomierte Pflegefachfrau sowie diplomierte Pflegeberaterin geschuldet ist. Dazu ist sie Mitglied der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats und reichte ein Postulat zum Sudan sowie eine Frage an den Bundesrat zur Situation in Gaza ein. Ausserdem reichte sie, neben vielen weiteren Geschäften, auch eine Interpellation zu Kriegsmaterialexporten nach Indien ein und stellte später in einer Fragestunde mehrere Anschlussfragen zur eingereichten Interpellation.
Für einen Journalisten war dieses letzte Geschäft Anlass genug, Rumy im Vorfeld eines Interviews Fragen zu ihrer Herkunft zu stellen (Farah Rumy ist die erste Nationalrätin mit sri-lankischen Wurzeln und kam im Alter von sechs Jahren in die Schweiz). Ob sie ursprünglich auch «aus dieser Region» komme, wollte der Journalist im Zusammenhang mit ihrer Rede zum «Freihandelsabkommen mit Indien» wissen. Und ob sie wegen ihres ethnischen Hintergrunds mehrmals das Wort zu diesem Geschäft ergriffen habe.
Farah Rumy tat das einzig Richtige: sie brach das Interview vorzeitig ab.
Es ist der übliche Reflex in der Schweiz, migrantische Personen auf ihre Herkunft zu reduzieren, anstatt ihre beruflichen Qualifikationen oder Leistungen gleichwertig anzuerkennen. Farah Rumy tat das einzig Richtige: sie brach das Interview vorzeitig ab.
So wie Farah Rumy geht es der überwältigenden Mehrheit der migrantischen Personen in der Schweizer Arbeitswelt, die regelmässig Alltagsrassismus erleben. Sie müssen sich dumme Sprüche über ihre «Landsleute» oder Stereotype über ihre Herkunft anhören, sich für Unterschiede im religiösen Alltag rechtfertigen oder ihnen werden aufgrund ihres Migrationshintergrunds ungewollte Attribute zugeschrieben.
Aus Angst vor negativen Konsequenzen oder der Gefahr «undankbar» zu wirken, suchen die Wenigsten bei solchen Vorkommnissen die Konfrontation. Stattdessen wird die Wut häufig heruntergeschluckt. Dabei wären, wie Farah Rumy es vorgemacht hat, Konfrontation und Aufklärung die beste Reaktion. Daneben sollten nicht nur migrantische Personen für sich einstehen müssen. Vor allem Angehörige der Mehrheitsgesellschaft haben die Aufgabe, das Auftreten von Alltagsrassismus zu erkennen und einzugreifen, indem sie z.B. Arbeitskolleg*innen nach rassistischen Aussagen zur Rede stellen.
Was oft vergessen geht: Hinter den persönlichen Erlebnissen von Alltagsrassismus steht ein strukturelles Problem: die fehlende Repräsentation. Weder in der Schweizer Politik noch in der Medienlandschaft sind migrantische Personen ausreichend repräsentiert, was dazu führt, dass ein grundlegendes Verständnis für migrantische Anliegen im Allgemeinen und Alltagsrassismus im Speziellen fehlt.
Vor allem Angehörige der Mehrheitsgesellschaft haben die Aufgabe, das Auftreten von Alltagsrassismus zu erkennen und einzugreifen.
Politische Ämter sind in der Schweiz in der Regel wenig bis gar nicht bezahlt. Die (aktive) politische Partizipation ist somit ein Luxus, den sich viele migrantische Personen nicht leisten können oder zu denen ihnen schlichtweg der Zugang fehlt. Die wenigen gut bezahlten Ämter sind in den Händen der Mehrheitsgesellschaft, die ihre Macht nur ungern teilt.
Zwar freuen sich alle Parteien über Stimmen von Menschen mit Migrationsgeschichte – aber wenn es darum geht, wer wirklich für ein politisches Amt aufgestellt wird, haben diese Personen oft schlechte Karten. Wenn überhaupt, landen sie meist ganz am Ende der Wahllisten – also mit kaum einer Chance, gewählt zu werden.
Ähnlich sieht es innerhalb der Schweizer Medienlandschaft aus, nur wenige Journalist*innen in der Schweiz haben einen Migrationshintergrund, und je weiter man in der Hierarchie nach oben geht, desto kleiner wird ihr Anteil. Dabei wäre ein höherer Anteil migrantischer Journalist*innen sowohl für die Themenauswahl als auch für die Art der Berichterstattung für eine diverse Medienlandschaft unerlässlich.
Wenn ihr also in nächster Zeit mit Alltagsrassismus konfrontiert seid, macht es wie Farah Rumy und schaut nicht weg, sondern reagiert direkt. Geht wählen und wählt vorzugsweise Kandierende mit Migrationshintergrund und schreibt bei rassistischer Berichterstattung an die jeweilige Zeitung. Und schliesslich solltet ihr, falls ihr es nicht sowieso schon seid, unbedingt Mitglied beim einzigen Medium mit einer migrantischen Chefredakteurin werden.
Von Nico Zürcher